Von Kinderpornographie zur Globalisierung der Polizeiarbeit
Christiane Schulzki-Haddouti 15.04.99Zwischenbilanz der BKA-Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität
 Seit
Januar recherchieren zwölf Polizeibeamte im Wiesbadener Bundeskriminalamt
"verdachtsunabhängig" im Internet. Acht Beamte in der BKA-Dependance
Meckenheim scannen das Netz nach rechts- und linksextremistischen Aufrufen.
"Eindrucksvoll" sei die erste Bilanz der BKA-Internetstreife, so BKA-Direktor
Leo Schuster in einem ersten Resümee. Im Herbst soll erstmals ein
detaillierter Erfahrungsbericht vorgelegt werden.
Seit
Januar recherchieren zwölf Polizeibeamte im Wiesbadener Bundeskriminalamt
"verdachtsunabhängig" im Internet. Acht Beamte in der BKA-Dependance
Meckenheim scannen das Netz nach rechts- und linksextremistischen Aufrufen.
"Eindrucksvoll" sei die erste Bilanz der BKA-Internetstreife, so BKA-Direktor
Leo Schuster in einem ersten Resümee. Im Herbst soll erstmals ein
detaillierter Erfahrungsbericht vorgelegt werden. In den ersten fünf Monaten wurden 40 linksextremistische Aufrufe zu Gewalttaten und 22 rechtsextremistische Internet-Botschaften entdeckt. Ebenso wurden 368 Fälle von Kinderpornographie registriert. Im gesamten Vorjahr sei das BKA nach Hinweisen oder Anfragen aus dem In- und Ausland mit rund 500 Fällen befaßt gewesen. Eine gewaltige Steigerungsrate - aus sich jedoch nicht folgern läßt, daß der Handel mit kinderpornographischen Bildern sich tatsächlich gesteigert hat. Nur: Auch bei der Strafverfolgung im Internet bewahrheitet sich eine Binsenwahrheit: Wer sucht, der findet.
Von den 500 Fällen im Vorjahr leitete das BKA 62 Prozent der Vorgänge
an das US-amerikanische FBI weiter. 9,6 Prozent der Fälle konnte das
BKA auf Täter in Japan zurückführen, 5,4 Prozent in den
Niederlanden, gefolgt von 3,3 Prozent in Großbritannien und 3,2 Prozent
in Rußland. Insgesamt gäbe es vor allem in den USA und Japan
die Tendenz, daß zunehmend neues pädophiles Material verwendet
werde.
Verdeckte Auftritte datenschutzrechtlich umstritten
 Das
Bundeskriminalamt setzt vor allem auf die abschreckende Wirkung der Internetstreife.
Verdeckte Ermittlungen sind den BKA-Beamten untersagt. Sie selbst dürfen
im Internet keine Bilder anbieten. Wenn sie jedoch in Chat-Räumen
unter Nicknames auftreten, gilt dies nach Auffassung des BKA nicht als
verdeckter Auftritt. Bundesdatenschützer Joachim Jacob ist hingegen
anderer Ansicht: In seinem neuen Jahresbericht, den er Anfang Mai vorlegte,
ist er der Auffassung, daß eine "getarnte Beteiligung an verdächtigen
einschlägigen Chat-Foren durch verdeckte Ermittler, einer ausdrücklichen
gesetzlichen Ermächtigung" bedürfe, da hier der staatliche Ermittler
dem Verdächtigen "nicht offen erkennbar" gegenübertrete. Es sei
noch ungeklärt, ob solche Eingriffe "anlaßunabhängig oder
verdachtsunabhängig" zugelassen werden dürfen, oder ob sie "nur
aufgrund eines hinreichend konkreten Verdachts oder einer hinreichend substantiierten
Gefahr" zugelassen werden sollen. Denn ein "wahlloses Beobachten " durch
die Polizei von nicht allgemein zugänglicher privater Kommunikation
würde "letztlich zu einem Einschüchterungseffekt führen,
der Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt und damit auch die Demokratie gefährden
könnte". Von diesen Einwänden will das BKA jedoch nichts wissen.
Alle Aktionen seien rechtlich hundertprozentig legitimiert.
Das
Bundeskriminalamt setzt vor allem auf die abschreckende Wirkung der Internetstreife.
Verdeckte Ermittlungen sind den BKA-Beamten untersagt. Sie selbst dürfen
im Internet keine Bilder anbieten. Wenn sie jedoch in Chat-Räumen
unter Nicknames auftreten, gilt dies nach Auffassung des BKA nicht als
verdeckter Auftritt. Bundesdatenschützer Joachim Jacob ist hingegen
anderer Ansicht: In seinem neuen Jahresbericht, den er Anfang Mai vorlegte,
ist er der Auffassung, daß eine "getarnte Beteiligung an verdächtigen
einschlägigen Chat-Foren durch verdeckte Ermittler, einer ausdrücklichen
gesetzlichen Ermächtigung" bedürfe, da hier der staatliche Ermittler
dem Verdächtigen "nicht offen erkennbar" gegenübertrete. Es sei
noch ungeklärt, ob solche Eingriffe "anlaßunabhängig oder
verdachtsunabhängig" zugelassen werden dürfen, oder ob sie "nur
aufgrund eines hinreichend konkreten Verdachts oder einer hinreichend substantiierten
Gefahr" zugelassen werden sollen. Denn ein "wahlloses Beobachten " durch
die Polizei von nicht allgemein zugänglicher privater Kommunikation
würde "letztlich zu einem Einschüchterungseffekt führen,
der Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt und damit auch die Demokratie gefährden
könnte". Von diesen Einwänden will das BKA jedoch nichts wissen.
Alle Aktionen seien rechtlich hundertprozentig legitimiert.
Die Kollegen von der für Kinderpornographie zuständigen US-Zollbehörde
dürfen als "agent provocateurs" arbeiten und können auf diese
Weise, so Schuster, tiefer in die Netzwerke von Händlern und Konsumenten
eindringen. Dort sind 16 Beamte tätig, doch allein in diesem Jahr
wird die Abteilung auf 60 Personen aufgestockt. Im Rahmen der Rechtshilfe
kann das Bundeskriminalamt Beweismittel anfordern. Schuster betonte, daß
vor Gericht allerdings nur die Beweismittel verwendet werden dürfen,
die "auf dem Boden des deutschen Rechts stünden. Nach Aussage von
Glenn Nick, dem Chef des "Cyber Smuggling Center" in der US-Zollbehörde,
werden Beweismittel jedoch an Deutschland weitergegeben - ungeachtet dessen,
ob sie aufgrund von verdeckten Ermittlungen erlangt wurden oder nicht.
Nach Auffassung der G8-Staaten ist dies legitim, da der ermittelnde Beamte
nur das nationale Gesetz beachten muß. Alles andere scheint bislang
eine Ermessensfrage der Gerichte zu sein, ob sie Beweismittel aus anderen
Ländern, die mit im Inland nicht genehmigten Methoden erlangt wurden,
anerkennen.
Globalisierung der Strafverfolgung
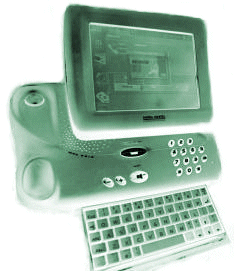 Unklar
ist die Erfolgsquote der Internetstreife, da die Fahnder ihre Erkenntnisse
an die Fachabteilungen des BKA sowie an die Landeskriminalämter weitergeben.
Welche Hinweise zu Festnahmen oder gar Prozessen geführt haben, läßt
sich jetzt noch nicht sagen. Erste Ergebnisse werden erst zum Jahresende
vorliegen. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt eindeutig auf Kinderpornographie.
Nur einige, wenige Fälle von Betrug sowie Verstöße gegen
das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz wurden bereits
ausgemacht. Leo Schuster ist sich sicher, daß mit der zunehmenden
Verbreitung des elektronischen Handels auch die über das Internet
verübten Betrugsdelikte steigen. Die hohe Zahl der Pädophilenfälle
erklärte er damit, daß diese Straftaten am leichtesten zu entdecken
seien. Betrügereien seien vergleichsweise aufwendiger zu recherchieren.
Noch konzentriere sich die BKA-Internetstreife auf Kinderpornographie,
eine Ausweitung auf andere Straftaten im Internet sei allerdings zu erwarten.
Unklar
ist die Erfolgsquote der Internetstreife, da die Fahnder ihre Erkenntnisse
an die Fachabteilungen des BKA sowie an die Landeskriminalämter weitergeben.
Welche Hinweise zu Festnahmen oder gar Prozessen geführt haben, läßt
sich jetzt noch nicht sagen. Erste Ergebnisse werden erst zum Jahresende
vorliegen. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt eindeutig auf Kinderpornographie.
Nur einige, wenige Fälle von Betrug sowie Verstöße gegen
das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz wurden bereits
ausgemacht. Leo Schuster ist sich sicher, daß mit der zunehmenden
Verbreitung des elektronischen Handels auch die über das Internet
verübten Betrugsdelikte steigen. Die hohe Zahl der Pädophilenfälle
erklärte er damit, daß diese Straftaten am leichtesten zu entdecken
seien. Betrügereien seien vergleichsweise aufwendiger zu recherchieren.
Noch konzentriere sich die BKA-Internetstreife auf Kinderpornographie,
eine Ausweitung auf andere Straftaten im Internet sei allerdings zu erwarten.
Leo Schuster ist davon überzeugt, daß mit der Globalisierung
der Information auch die Globalisierung der Kriminalität einhergeht.
Die internationale Kooperation von Strafverfolgern müsse daher vorangetrieben
worden. Das BKA arbeitet im Rahmen der "European Working Party on Information
Technology Crime" bei Interpol, im Expertenkomitee für Datennetzkriminalität
"PC-CY" der Europäischen Union und der Arbeitsgruppe "High-Tech
Crime" der G8-Staaten mit anderen nationalen Polizeiorganisationen zusammen.
Innerhalb der EU und den G8-Staaten versuchen die Staaten sich auf "gemeinsame
Handlungsmuster" in der Strafverfolgung im Internet zu einigen. Dabei müssen
unter Umständen auch Rechtsnormen angepaßt werden. Im G8-Mitgliedsstaat
Japan ist bis heute die digitale Verbreitung von Kinderpornographie nicht
verboten. Jetzt soll ein Gesetz die Verbreitung kinderpornographischer
Materialien auch in Japan unter Strafe stellen.
Fehlanzeige bei Urheberrechtsverstößen und Geldwäsche
 Während
in den USA Urheberrechtsverletzungen zunehmend verfolgt werden, ist das
beim deutschen Bundeskriminalamt noch kein Thema. Zwar wird, so betont
Schuster, grundsätzlich alles verfolgt, was gegen deutsches Recht
verstößt. In einigen Deliktsbereichen gibt es jedoch noch keine
Trefferquoten. illionenschwere Schäden fürchtet die US-Industrie
durch die illegale Reproduktion von Audio- und Video-CDs. Selbst um Songtexte
macht sich die Musikbranche Sorgen - vor eineinhalb Jahren mußte
der US-Zoll für den Country-Music-Verband aktiv werden. Die Unterhaltungsindustrie
setzt jetzt die Politik massiv unter Druck, damit sie mehr Mittel in mehr
Strafverfolger investiert. Auch in anderen Ländern sollen die Urheberrechtsverstöße
verfolgt werden - in Deutschland: Fehlanzeige. Grund ist wohl die mangelnde
politische Unterstützung - ansonsten hätten wohl schon längst
Ermittlungen stattgefunden.
Während
in den USA Urheberrechtsverletzungen zunehmend verfolgt werden, ist das
beim deutschen Bundeskriminalamt noch kein Thema. Zwar wird, so betont
Schuster, grundsätzlich alles verfolgt, was gegen deutsches Recht
verstößt. In einigen Deliktsbereichen gibt es jedoch noch keine
Trefferquoten. illionenschwere Schäden fürchtet die US-Industrie
durch die illegale Reproduktion von Audio- und Video-CDs. Selbst um Songtexte
macht sich die Musikbranche Sorgen - vor eineinhalb Jahren mußte
der US-Zoll für den Country-Music-Verband aktiv werden. Die Unterhaltungsindustrie
setzt jetzt die Politik massiv unter Druck, damit sie mehr Mittel in mehr
Strafverfolger investiert. Auch in anderen Ländern sollen die Urheberrechtsverstöße
verfolgt werden - in Deutschland: Fehlanzeige. Grund ist wohl die mangelnde
politische Unterstützung - ansonsten hätten wohl schon längst
Ermittlungen stattgefunden.
Ebenfalls noch kein Thema in Deutschland ist die Geldwäsche via
Internet. In den USA wird bereits gezielt nach Online-Banken gefahndet,
die die Einrichtung anonymer Konten ermöglichen. Auch Investitionsbetrug
wird vom BKA noch nicht gezielt verfolgt. In den USA richtete das die
"Security and Exchange Commission" bereits ein spezielles Programm gegen
Internetbetrug ein. Es untersucht, ob via Internet Marktmanipulationen
vorgenommen werden oder eine Firma auf illegale Weise beworben wird. Im
Gegensatz zu den Pädophilen, die ihre Kommunikation zunehmend in abgeschlossenen
Räumen pflegen, müssen Investitionsbetrüger in das Licht
der Öffentlichkeit, um möglichst viele Kunden anzulocken. Für
die Strafverfolger genügen daher zwei Stunden Surfen pro Woche, um
einen ganzen Stapel an mutmaßlichen Internetbetrügereien zu
entdecken. Werbemails oder Websites betrügerischer Bank-, Aktien-
und Investmentangebote lassen sich in der Regel an unglaubwürdigen
Konditionen erkennen. Stichworte wie "Kreditzinsen nur 2 Prozent" genügen,
um über Suchmaschinen verdächtige Angebote aus dem Netz zu fischen.
Provider kooperieren?
 Bei
der Strafverfolgung der Anbieter setzt das BKA auf eine enge Zusammenarbeit
mit den Internet Service Providern. Seit dem ersten Treffen im Dezember
hat es bereits zwei weitere Zusammenkünfte gegeben. In den nächsten
zwei Monaten soll eine freiwillige Selbstverpflichtung erarbeitet werden,
die "ohne strafrechtliche Konsequenzen" bleiben soll. Ziel: Provider sollen
sich an einen "Rund-um-die-Uhr-Service" wenden können, falls sie auf
verdächtiges Material stoßen. Offen ist, in welchen Fällen
Provider überhaupt von sich aus aktiv werden dürfen, ohne das
Fernmeldegeheimnis zu verletzen. Auch sollen Kontaktstellen für die
nationale und internationale Kooperation eingerichtet werden. Auch die
Polizei soll sich direkt an die Provider wenden können, damit diese
Beweisdaten sichern.
Bei
der Strafverfolgung der Anbieter setzt das BKA auf eine enge Zusammenarbeit
mit den Internet Service Providern. Seit dem ersten Treffen im Dezember
hat es bereits zwei weitere Zusammenkünfte gegeben. In den nächsten
zwei Monaten soll eine freiwillige Selbstverpflichtung erarbeitet werden,
die "ohne strafrechtliche Konsequenzen" bleiben soll. Ziel: Provider sollen
sich an einen "Rund-um-die-Uhr-Service" wenden können, falls sie auf
verdächtiges Material stoßen. Offen ist, in welchen Fällen
Provider überhaupt von sich aus aktiv werden dürfen, ohne das
Fernmeldegeheimnis zu verletzen. Auch sollen Kontaktstellen für die
nationale und internationale Kooperation eingerichtet werden. Auch die
Polizei soll sich direkt an die Provider wenden können, damit diese
Beweisdaten sichern. Die G8-Arbeitsgruppe "High-Tech Kriminalität" hat eine 24-Stunden-Kontaktgruppe gegründet, die sich über die Landesgrenzen hinweg hilft: Führen beispielsweise die Spuren eines Falls in Deutschland in die USA, nimmt der US-Kontaktmann mit dem betroffenen US-Provider Kontakt auf, um Beweisdaten sicher zu stellen. Umgekehrt hilft die Internetstreife, die rund um die Uhr arbeitet, den Kollegen in den G8-Staaten.
Ein Vorschlag der Arbeitsgruppe zur Beweissicherung elektronischer Daten, die sogenannte "Preservation Order", wurde bereits in den EU-Rat eingebracht, der zur Zeit an dem Entwurf einer "Cyber Crime Convention" arbeitet. Die Konvention soll als verbindliche Abmachung den EU-Mitgliedstaaten und sogenannten beobachtenden Ländern, USA, Kanada und Japan die internationale Strafverfolgung erleichtern. Ekkehart Kappler, der für die internationale Zusammenarbeit zuständige Beamte im BKA, erwartet, daß die Konvention frühestens im nächsten Jahr im EU-Rat verabschiedet wird.
Die "Preservation Order" sieht vor, daß die Internet Service Provider auf Bitte der Strafverfolger die Kommunikationsdaten des Verdächtigen sofort einfrieren und speichern. Mit einer richterlichen Genehmigung kann die Polizei dann die Daten beschlagnahmen und auswerten. Während die Amerikaner sich eine Speicherfrist von 90 Tagen wünschen, votiert die deutsche Delegation für eine Speicherfrist von zwischen 7 und 30 Tagen. Fraglich ist, ob die deutschen Datenschützer dieser Regelung zustimmen werden. Bereits im Gesetzgebungsverfahren zum Informations- und Kommunikationsgesetz (IuKDG) hatten die Datenschützer weitergehende Auskunfts-, Mindestspeicherungs- und Identitätskontrollpflichten scharf kritisiert. Eine ursprünglich enthaltene Vorschrift war darauf im Verlauf des Verfahrens wieder gestrichen worden.
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/2419/1.html
Dienstag, 22. Juni 1999, 11:15 Uhr
Streit um elektronische Fußfessel
Baden-Württemberg will überwachten Hausarrest nur als Ersatz für Geldstrafe
 Stuttgart
(AP) Um den Einsatz der sogenannten elektronischen Fußfessel
bahnt sich ein Streit zwischen Baden-Württemberg und Bundesjustizministerin
Herta Däubler-Gmelin an. Der baden-württembergische Justizminister
Ulrich Goll sagte am Dienstag in Stuttgart, der elektronisch überwachte
Hausarrest solle nur als Ersatz für eine Geldstrafe verhängt
werden. «Im Gegensatz zur Bundesjustizministerin halten wir nichts
davon, daß Strafgefangene ihre Freiheitsstrafe zu Hause absitzen»,
erklärte der FDP-Politiker.
Stuttgart
(AP) Um den Einsatz der sogenannten elektronischen Fußfessel
bahnt sich ein Streit zwischen Baden-Württemberg und Bundesjustizministerin
Herta Däubler-Gmelin an. Der baden-württembergische Justizminister
Ulrich Goll sagte am Dienstag in Stuttgart, der elektronisch überwachte
Hausarrest solle nur als Ersatz für eine Geldstrafe verhängt
werden. «Im Gegensatz zur Bundesjustizministerin halten wir nichts
davon, daß Strafgefangene ihre Freiheitsstrafe zu Hause absitzen»,
erklärte der FDP-Politiker. Däubler-Gmelin hatte betont, vorstellbar sei ein Einsatz im offenen Vollzug. Für Verurteilte, die Geldstrafen nicht bezahlt hätten und deshalb eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, sei dies dagegen keine Alternative. Die Betreuung der Täter könne nicht durch Bewachung ersetzt werden, «und schon gar nicht durch die elektronische Überwachung». Das Recht auf Menschenwürde müsse gewahrt werden: «Daraus ergibt sich, daß der Anwendungsbereich der Fußfessel extrem gering sein wird.»
Baden-Württemberg hat bereits angekündigt, den elektronischen
Hausarrest bei Ersatzfreiheitsstrafen erproben zu wollen. Die Justizministerin
hatte kritisiert, sie halte dies für den falschen Weg. Die Justizminister
der Länder mit Ausnahme Sachsens hatten vor kurzem geplante Modellversuche
mit der neuen Form des Strafvollzugs gebilligt. Goll sagte, die SPD-Politikerin
habe an den Beratungen teilgenommen. Es sei bedauerlich, daß sie
nicht dort die Gelegenheit ergriffen habe, ihre Bedenken vorzubringen.
Der FDP-Politiker betonte, daß in Baden-Württemberg gemeinnützige
Arbeit zur Ableistung von Ersatzfreiheitsstrafen angeboten werde. Im Jahr
1997 hätten knapp 2.000 Gefangene mehr als 73.000 Hafttage abgebaut.
‘Electronic Monitoring’
Die elektronische Überwachung von Straffälligen
Massentest für elektronische Fessel
Florian Rötzer 28.01.99England und Wales wollen jährlich 30000 Gefangene vorzeitig entlassen.
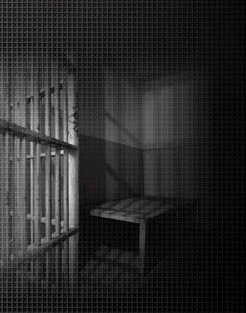 Großbritannien
hat in England und Wales sozusagen einen Massentest mit der elektronischen
Überwachung begonnen. Seit heute werden Häftlinge mit einer Strafe
zwischen drei Monaten und vier Jahren bis zu zwei Monate früher entlassen,
wenn sie für die Öffentlichkeit kein Risiko darstellen und eine
elektronische Fessel tragen.
Großbritannien
hat in England und Wales sozusagen einen Massentest mit der elektronischen
Überwachung begonnen. Seit heute werden Häftlinge mit einer Strafe
zwischen drei Monaten und vier Jahren bis zu zwei Monate früher entlassen,
wenn sie für die Öffentlichkeit kein Risiko darstellen und eine
elektronische Fessel tragen. Weil die vorzeitige Entlassung nicht schon die ganze Freiheit schenken, sondern den Häftlingen erleichtern soll, sich wieder an das Leben außerhalb der Gefängnismauern anzupassen, werden sie zu einem mindestens neunstündigen Ausgehverbot verpflichtet, das in aller Regel in der Nacht wirksam sein wird. Die während dieser Zeit obligatorische zu tragende Fessel ist mit einem Kontrollzentrum verbunden, von dem aus überprüft werden kann, ob der Träger während des Ausgehverbots sich auch tatsächlich Zuhause aufhält. Wenn der vorzeitig Entlassene die Fessel entfernt oder wieder eine Straftat begeht, wird er, sofern man ihn denn erwischt, wieder ins Gefängnis zurückgebracht.
Die Entscheidung über die vorzeitige Entlastung liegt in den Händen
der Gefängnisdirektoren. Gewalttäter und Sexualstraftäter
sollen allerdings nur unter außergewöhnlichen Umständen
vorzeitig entlassen werden. Vorgesehen ist, jährlich an die 30000
Gefangenen vorzeitig zu entlassen und an die elektronische Fessel zu hängen.
Grund dafür ist vermutlich nicht nur, den Straftätern größere
Chancen zur Anpassung an das Leben in der Freiheit zu geben, sondern auch
die Überfüllung der Gefängnisse. In Holland wurden in einer
ähnlichen, wenn auch im Umfang viel kleineren Aktion bislang 300 Gefangene
vorzeitig mit der elektronischen Fessel entlassen. Nur einer ist bislang
wieder eingesperrt worden.
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/1788/1.html
Gefängnis unter freiem Himmel
Florian Rötzer 13.01.99Erstes GPS-basiertes System zur Überwachung von Strafgefangenen in Echtzeit
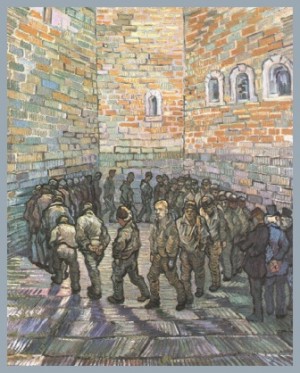 Endlich
ist es soweit, und die Justizminister und Gefängnisdirektoren können
aufatmen. SecurityLink von Ameritech.com bietet jetzt den überlasteten
Gefängnissen den Himmel als Ausweg an, wie eine Formulierung in der
Pressemitteilung lautet. Mit SMART (Satellite Monitoring
and Remote Tracking System) läßt sich jetzt über
das Global Positioning System der Aufenthaltsort von Straftätern,
die keine Gefängnisstrafe ableisten müssen, sondern Hausarrest
haben, zur Arbeit gehen dürfen oder auf Bewährung entlassen wurden,
"24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche" in Echtzeit überwachen.
Endlich
ist es soweit, und die Justizminister und Gefängnisdirektoren können
aufatmen. SecurityLink von Ameritech.com bietet jetzt den überlasteten
Gefängnissen den Himmel als Ausweg an, wie eine Formulierung in der
Pressemitteilung lautet. Mit SMART (Satellite Monitoring
and Remote Tracking System) läßt sich jetzt über
das Global Positioning System der Aufenthaltsort von Straftätern,
die keine Gefängnisstrafe ableisten müssen, sondern Hausarrest
haben, zur Arbeit gehen dürfen oder auf Bewährung entlassen wurden,
"24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche" in Echtzeit überwachen. Das biete den Strafvollzugsbehörden just zu der Zeit, in der sie es am nötigsten haben, die "ultimative elektronische Überwachungslösung", preist Ed Maier von SecurityLink die Technik an. "Mit den weiterhin steigenden Gefängniskosten hat sich die Zahl der Straftäter in alternativen Programmen wie dem Hausarrest oder dem Arbeitsfreigang seit 1995 auf mehr als 70000 Menschen verdoppelt." Bislang konnte man auch mit der "elektronischen Fessel" den Aufenthaltsort der Straftäter nicht in Echtzeit erkennen. Der Fußreif mit einem Sender ist hier mit dem Telefon verbunden, das angewählt werden muß, um ihn zu aktivieren. Das GPS-basierte System hingegen registriert permanent die Signale, die zusammen mit den Ortskoordinaten der GPS-Satelliten an ein zentrales Überwachungszentrum gesendet werden, das die Bewegungen des Straftäters anhand von Karten aufzeichnet. Der Sender am Fuß sollte daher permanent getragen werden. Wenn er entfernt wird, wird auch die Verbindung unterbrochen und Alarm ausgelöst.
Die Bewegungsfreiheit der SMART-überwachten Straftätern könne man so auf bestimmte Gebiete einschränken und andere für tabu erklären. Alarm würde auch ausgelöst, wenn der Straftäter den erlaubten Bereich überschreitet, so daß die Polizei möglicherweise gefährdete Opfer und Zeugen warnen könne.
SMART kostet etwa 15 Dollar am Tag, die alte elektronische Fessel etwa 8 Dollar, was zu einem Hindernis werden könnte. Ein Tag im Gefängnis allerdings bringt Kosten von 55 Dollar mit sich. Das ist jedenfalls ein ökonomisches Argument dafür, die nicht wegen Gewalttaten Bestraften eher zum panoptischen Objekt unter freiem Himmel zu machen.
Gerade eben hat das US-Justizministerium eine neue Statistik vorgelegt, die tatsächlich für die GPS-Überwachung sprechen könnte. Seit 1990 ist die Zahl der Strafgefangenen jährlich um 7 Prozent gestiegen. Wegen neuerer Gesetze sitzen die Menschen nämlich länger hinter Gittern, da sie erst einmal einen wesentlichen Anteil ihrer Strafe vor der Freilassung abbüßen müssen. Seit 1990 ist die Zahl derjenigen, die ihre volle Strafe absitzen mußten, um 6 Prozent gestiegen. 70 Prozent derjenigen, die wegen einer Gewalttat 1997 eingesperrt wurden, befinden sich in einem Bundesstaat, in dem sie mindestens 85 Prozent der Strafzeit absitzen müssen. Gleichzeitig ist natürlich das Verhältnis der Freigelassenen zu den Einsitzenden von 37 zu 100 im Jahr 1990 auf 31 zu 100 im Jahr 1996 gesunken. Gemäß dieser Tendenz werden die Gefängnisse immer voller.
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/1760/1.html
Flächendeckende Überwachung
Florian Rötzer 14.03.99Israel ist Pionier bei der Einführung von Handscannern für die Grenzkontrolle
 Auch
wenn angeblich die Bedeutung von Grenzen im Zeitalter des Internet sinkt,
so wird doch die Mobilität der Menschen noch immer durch Grenzen beschränkt
und kontrolliert - und die Sicherung der Grenzen geschieht natürlich
heute durch High-Tech. Grenzübergänge sollen anhand der Überprüfung
der Identität der Menschen die Ein- und Ausreise der Menschen kontrollieren.
War bislang dafür die Grundlage der ID-Ausweis mit Nummer, Bild, eventuell
Fingerabdruck und anderen Angaben wie Adresse, Körpergröße
oder Augenfarbe, so liegt die Zukunft in Smart Cards und biometrischen
Identifikationssystemen. Darin rücken sich auch Online- und Offline-Welt
einander näher.
Auch
wenn angeblich die Bedeutung von Grenzen im Zeitalter des Internet sinkt,
so wird doch die Mobilität der Menschen noch immer durch Grenzen beschränkt
und kontrolliert - und die Sicherung der Grenzen geschieht natürlich
heute durch High-Tech. Grenzübergänge sollen anhand der Überprüfung
der Identität der Menschen die Ein- und Ausreise der Menschen kontrollieren.
War bislang dafür die Grundlage der ID-Ausweis mit Nummer, Bild, eventuell
Fingerabdruck und anderen Angaben wie Adresse, Körpergröße
oder Augenfarbe, so liegt die Zukunft in Smart Cards und biometrischen
Identifikationssystemen. Darin rücken sich auch Online- und Offline-Welt
einander näher. An Flughäfen werden bereits "intelligente" Videoüberwachungssysteme installiert, die das Gesicht von Menschen, selbst wenn es verändert wurde, mit einer Datenbank von Fotos gesuchter oder verdächtiger Personen überprüfen. Aber deren Erfolgsquote ist relativ gering, überdies sind die Systeme noch zu langsam.
Israel hat nicht nur das Problem, sich gegen eindringende Terroristen schützen zu müssen, sondern an den Grenzübergängen täglich eine Flut von im Land arbeitenden Palästeinensern bewältigen zu müssen, die morgens einreisen und abends das Land wieder verlassen. Am Grenzübergang in Erez werden so etwa täglich 35000 Palästinenser überprüft, die in Israel arbeiten und im Gaza-Streifen leben. Aus Angst vor Terroranschlägen werden sie sorgfältig untersucht, was lange Wartezeiten bedeutet und die Spannung zwischen Palästinensern und den israelischen Soldaten fördert. Jetzt soll in Erez ein automatisches Erkennungssystem die Wartezeiten abbauen.
Bereits letzten Frühling testete die israelische Polizei, wie Sunday Times berichtet, in einem Lager die biometrischen Idendifikationssysteme von unterschiedlichen Firmen. Angeboten werden Systeme zur Erkennung der Fingerabdrücke, der Iris und der Stimme. Die meisten hielten jedoch dem Massentest nicht stand, weil sie zu langsam oder zu ungenau arbeiteten. Favorit ist offenbar ein Handlesesystem von Tadiran Information Systems .
Vorgesehen ist ein Terminal am Grenzübergang. Die Palästinenser aus Gaza erhalten eine Smart Card mit ihren persönlichen Daten, die zuerst bei der Ein- und Ausreise eingeführt werden muß. Danach müssen sie ihre Hand auf den RSI Scanner halten. Die Identifikation soll nur wenige Sekunden benötigen. Danach geht die Schranke hoch und kann die Grenze passiert werden. Im Einsatz ist das System bereits am Ben Gurion Flughafen für Vielflieger der Linie El Al, aber auch im Außenministerium und in einem Krankenhaus. Innerhalb der nächsten Jahre soll es, wenn es sich in Erez bewährt, an allen 32 Grenzübergängen installiert und zu einem einzigen Netzwerk verbunden werden. So können etwa auch Palästinenser, die unerlaubterweise über Nacht in Israel bleiben, erfasst werden.
Oded Katzir von Tadiran weist auf das Ausmaß der dadurch möglichen Kontrolle nicht nur an der Grenze hin: "In der Abschlußphase des Vorhabens werden 1000 Streifenwagen der Polizei über Radio und Computer mit dem zentralen Grenzkontrollsystem verbunden. Wenn Polizisten jemandem begegnen, den sie verdächtigen, illegal die Grenze überschritten zu haben, brauchen sie nur dessen Smart Card in den Computer in ihrem Streifenwagen stecken, um seine Identität zu überprüfen und zu sehen, wann er die Grenze passiert und ob er eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt."
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/1963/1.html
Auskunftsrecht nach § 15 BVerfSchG, passim
Wir geben nicht nach ... (Erich Mühsam, zu singen) - Wir wollen unsereAkte - weg mit dem »Verfassungsschutz«!
Implantierte Chips für die Prominenten
Florian Rötzer 11.10.98
 Die
Reichen und Berühmten könnten aber nur die ersten Versuchsobjekte
sein
Die
Reichen und Berühmten könnten aber nur die ersten Versuchsobjekte
sein
Prominente stehen an der Spitze der Aufmerksamkeitsökonomie und besitzen
in aller Regel einiges an Geld. Deswegen sind sie auch das Ziel von Entführern
und umgeben sich und ihre Familien mit Leibwächtern. Das ist nicht
nur angenehm. Auch ihre Häuser werden zu Festungen umgebaut. Nicht
zuletzt wegen der Prominenten und Reichen boomt die Sicherheitsindustrie.
Im letzten Jahr stellte die Entführungsbranche mit weltweit über
1400 Kidnappings einen Rekord ein. Seit 1990 ist sie um 60 Prozent gewachsen. Ist aber jemand erst einmal erfolgreich entführt, so ist sein Aufenthaltsort unbekannt, wenn sich die Kidnapper nicht allzu ungeschickt angestellt haben. Die Firma Gen-Etics also hat sich gedacht, wie die Sunday Times berichtet, warum man mit dem Global Positioning System nicht auch den Aufenthaltsort von entführten Menschen feststellen sollte, wenn man dies mit gestohlenen Autos schon macht. Man implantiert den Entführungsgefährdeten einfach einen Chip unter die Haut, der Signale sendet. Über das GPS läßt sich dann ziemlich genau der Aufenthaltsort des Opfers herausfinden - und man kann versuchen, die Entführer zu überrumpeln.
Erfunden hat den Chip offenbar der israelische Geheimdienst Mossad für seine Agenten. Gen-Etics hat den Chip für den Markt nur weiter entwickelt und ihn zu Testzwecken bereits 43 Europäern und zwei Amerikanern eingepflanzt, deren Identität aber nicht preisgegeben wird. Implantiert wird er unter einer leichten Betäubung, so daß die Träger selbst nicht wissen, wo er sich befindet. Nur eine winzige Narbe sei sichtbar. An Fingern, Nasen oder Ohren werde er nicht angebracht, da diese Körperteile von Entführern manchmal als Beweis abgeschnitten und den Familienangehörigen zugeschickt werden. Der Chip ist nur 4 x 4 mm groß und besteht aus synthetischen und organischen Materialien. Für Röngenstrahlen sei er nicht sichtbar. An Energie benötigt er vier Milliampere, die er aus dem Körper bezieht. Eine Batterie ist also nicht nötig. Und wenn der Chip keine Signale mehr sendet, kann man davon ausgehen, daß der Träger tot ist, weil sein Körper keine Energie mehr liefert.
Die Firma sieht einen Markt für die Chips bei Prominenten, Politikern, Reichen und Managern, die sich an Orte begeben müssen, an denen die Wahrscheinlichkeit einer Entführung besteht. Allerdings werden die Kidnapper auf solche Gadgets entsprechend reagieren. Sie werden ihre Opfer genauestens absuchen und den Chip entfernen, ihre Verstecke sichern oder sie so abschirmen, daß die Signale nicht mehr zu den Satelliten gelangen.
Wahrscheinlich aber sind die Prominenten gar nicht der Markt für solche Chips. Möglicherweise dienen sie nur als freiwillige Testpersonen und helfen mit ihrem Geld, solche Überwachungsgadgets als billige Massenware herzustellen. Schließlich wären die Chips eine wunderbare elektronische Fessel, die zur Entlastung der Gefängnisse dienen könnte. Oder man implantiert sie gleich Wiederholungstätern, um sie vor neuen Verbrechen abzuhalten.
http://www.heise.de/bin/tp/issue/dl-artikel.cgi?artikelnr=2496&mode=html
Gefängnisse als arbeitsmarktpolitische Maßnahme
Florian Rötzer 03.08.98Eine Studie amerikanischer Soziologen sucht am US-amerikanischen Arbeitsmarktwunder zu kratzen
 Eben
veröffentlichte das amerikanische Justizministerium einen Bericht,
aus dem hervorgeht, daß die Zahl der Strafgefangenen in den USA mit
1,25 Millionen einen Höchststand erreicht habe, auch wenn die Wachstumsrate
mit 5,2 Prozent im Jahr 1997 niedriger als das durchschnittliche Wachstum
von 7 Prozent seit Beginn der 90er Jahre war. Seit 1990 stieg die Zahl
der Menschen in den Gefängnissen um 60 Prozent an. Allein im letzten
Jahr kamen über 60000 neue Strafgefangene hinzu. Überdies befinden
sich in den lokalen Gefängnissen noch über 560000 Menschen, die
auf ihren Prozeß warten oder eine Gefängnisstrafe von unter
einem Jahr verbüßen. Insgesamt sind die Gefängnisse überbelegt.
Eben
veröffentlichte das amerikanische Justizministerium einen Bericht,
aus dem hervorgeht, daß die Zahl der Strafgefangenen in den USA mit
1,25 Millionen einen Höchststand erreicht habe, auch wenn die Wachstumsrate
mit 5,2 Prozent im Jahr 1997 niedriger als das durchschnittliche Wachstum
von 7 Prozent seit Beginn der 90er Jahre war. Seit 1990 stieg die Zahl
der Menschen in den Gefängnissen um 60 Prozent an. Allein im letzten
Jahr kamen über 60000 neue Strafgefangene hinzu. Überdies befinden
sich in den lokalen Gefängnissen noch über 560000 Menschen, die
auf ihren Prozeß warten oder eine Gefängnisstrafe von unter
einem Jahr verbüßen. Insgesamt sind die Gefängnisse überbelegt. Die steile Zunahme der Gefängnisinsassen setzte in den 80er Jahren ein. Hat dieser Trend etwas mit dem Erfolg der amerikanischen Wirtschaft zu tun, die neben dem Boom der Gefängnisbevölkerung mit immer geringeren Zahlen von Arbeitslosen aufwartet?
Der Abbau des Sozialstaates und eine weitgehende Deregulierung des Arbeitsmarktes werden noch immer als Erfolgsformeln verkauft, wie auch in Europa die Wirtschaft in Schwung kommen kann und sich die Arbeitslosenzahlen vermindern lassen. Das große Vorbild ist die USA mit Großbritannien als dem europäischen Nachfolgemodell. Beide sollen jetzt nach der harten Hand von Reagan und Thatcher vom wirtschaftlichen Umbau profitieren - und die sinkende Zahl der Arbeitslosen scheint dem neoliberalen Rezept den Rücken zu stärken.
 Aber
der liberale Markt ist nur die eine Seite des "Erfolgs", bei der man gerne,
indem man Statistiken und gesellschaftliche Bereiche säuberlich trennt,
eine andere übersieht: der Aufschwung des freien Marktes geht einher
mit der Konjunktur einer Law-and-Order-Politik, durch die die private Sicherheitsindustrie,
aber auch der Polizeistaat gefördert werden. Die Gefängnisse
füllen sich und platzen aus den Nähten, obgleich die Kriminalitätsrate
nicht zunimmt, während man überall aufrüstet und neue Gesetze
und Techniken zur Überwachung einführt. Was dem Nationalstaat
an Macht durch die wirtschaftliche Globalisierung aus den Händen gleitet,
wird durch den Ausbau der "inneren Sicherheit" kompensiert - und gleichzeitig
ist das anschwellende Strafsystem eine staatliche Regulierung des Arbeitsmarktes,
also eine Institution des Arbeitsmarktes, wie Bruce Western und Katherine
Beckett in ihrer provokativen Studie How unregulated is the U.S. Labor
Market? ausführen.
Aber
der liberale Markt ist nur die eine Seite des "Erfolgs", bei der man gerne,
indem man Statistiken und gesellschaftliche Bereiche säuberlich trennt,
eine andere übersieht: der Aufschwung des freien Marktes geht einher
mit der Konjunktur einer Law-and-Order-Politik, durch die die private Sicherheitsindustrie,
aber auch der Polizeistaat gefördert werden. Die Gefängnisse
füllen sich und platzen aus den Nähten, obgleich die Kriminalitätsrate
nicht zunimmt, während man überall aufrüstet und neue Gesetze
und Techniken zur Überwachung einführt. Was dem Nationalstaat
an Macht durch die wirtschaftliche Globalisierung aus den Händen gleitet,
wird durch den Ausbau der "inneren Sicherheit" kompensiert - und gleichzeitig
ist das anschwellende Strafsystem eine staatliche Regulierung des Arbeitsmarktes,
also eine Institution des Arbeitsmarktes, wie Bruce Western und Katherine
Beckett in ihrer provokativen Studie How unregulated is the U.S. Labor
Market? ausführen.
 Die
amerikanische Strategie der Nulltoleranz, also der verstärkten Strafverfolgung
und Aburteilung und damit auch der Vermehrung der arbeitslosen, aber in
der Statistik nicht als Arbeitslose erscheinenden Gefängnisinsassen,
scheint auch hierzulande bei Politikern auf Wohlgefallen zu stoßen.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, in der man Flexibilität fordert,
das Einkommen sinkt und die Menschen nicht mehr wissen, ob sie morgen noch
Arbeit haben, wollen die Wähler offenbar wenigstens vor Kriminellen
und Gewalt sicher sein. Schon seit langem jedenfalls ließen sich
nicht mehr so ungestört durch Kritik neue Gesetze einführen,
die trotz aller Ideologie der Selbständigkeit, Flexibilität,
Risikobereitschaft, Bürokratiereduktion und individueller Freiheit
Stück für Stück die Bürgerrechte einschränken
und die privaten Räume verkleinern. Selbst die Opposition scheint
nur gebannt auf innere Sicherheit zu schauen und nahezu bedingungslos allen
Maßnahmen vom Großen Lauschangriff über die Gendatei bis
hin zur Erweiterung der Befugnisse des Bundesgrenzschutzes zuzustimmen.
Der SPD-Kanzlerkandidat Schröder forderte unlängst gar noch,
straffällig gewordene Jugendliche in geschlossene Heime wegzusperren.
Auch Liberale wie Guido Westerwelle befürworten solche Maßnahmen,
mit denen sich die Jugendlichen von der Straße wegholen und die Arbeitslosenstatistiken
beschönigen lassen.
Die
amerikanische Strategie der Nulltoleranz, also der verstärkten Strafverfolgung
und Aburteilung und damit auch der Vermehrung der arbeitslosen, aber in
der Statistik nicht als Arbeitslose erscheinenden Gefängnisinsassen,
scheint auch hierzulande bei Politikern auf Wohlgefallen zu stoßen.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, in der man Flexibilität fordert,
das Einkommen sinkt und die Menschen nicht mehr wissen, ob sie morgen noch
Arbeit haben, wollen die Wähler offenbar wenigstens vor Kriminellen
und Gewalt sicher sein. Schon seit langem jedenfalls ließen sich
nicht mehr so ungestört durch Kritik neue Gesetze einführen,
die trotz aller Ideologie der Selbständigkeit, Flexibilität,
Risikobereitschaft, Bürokratiereduktion und individueller Freiheit
Stück für Stück die Bürgerrechte einschränken
und die privaten Räume verkleinern. Selbst die Opposition scheint
nur gebannt auf innere Sicherheit zu schauen und nahezu bedingungslos allen
Maßnahmen vom Großen Lauschangriff über die Gendatei bis
hin zur Erweiterung der Befugnisse des Bundesgrenzschutzes zuzustimmen.
Der SPD-Kanzlerkandidat Schröder forderte unlängst gar noch,
straffällig gewordene Jugendliche in geschlossene Heime wegzusperren.
Auch Liberale wie Guido Westerwelle befürworten solche Maßnahmen,
mit denen sich die Jugendlichen von der Straße wegholen und die Arbeitslosenstatistiken
beschönigen lassen.
Auch in der BRD wächst offenbar die Bereitschaft, Straftäter wegzusperren. Jedenfalls stieg die Zahl der Gefangenen allein in Bayern von 9700 im Jahr 1991 auf jetzt über 12000 (SZ vom 13.7.98). Bundesweit läßt sich nach dem Statistischen Bundesamt Deutschland ebenfalls ein Anstieg der Strafgefangenen registrieren. Waren es 1995 noch 46500, so 1997 bereits 51600. In Rheinland-Pfalz überlegt man bereits - wieder nach dem Vorbild USA oder Großbritannien -, den Bau neuer Gefängnisse und den Strafvollzug privatwirtschaftlich zu organisieren. Der Trend ist deutlich zu sehen, aber noch nichts im Vergleich zu den Vorbildstaaten. In den USA wurden in den letzten fünf Jahren über 200 neue Gefängnisse gebaut, vermehrte sich die Zahl der Angestellten allein in den staatlichen Gefängnissen von 260000 auf 350000 und hat sich seit 1975 die Zahl der Gefängnisinsassen verdreifacht. Über 1,7 Millionen Menschen, so das Justizministerium , sitzen in staatlichen, regionalen oder privaten Gefängnissen, d.h. auf 100000 Einwohner kamen im Jahr 600 Häftlinge, Tendenz noch immer steigend. Seit 1990 sind durchschnittlich 1708 Strafgefangene wöchentlich hinzugekommen. Jeder 155. US-Bürger befindet sich hinter Gittern, darunter überproportional viele Schwarze. Nimmt man noch die Verurteilten hinzu, die auf Ehrenwort (parole) oder auf Bewährung (probation) außerhalb der Gefängnisse leben, aber unter Aufsicht stehen, so sind über 5 Millionen Menschen direkt in das Überwachungs- und Strafsystem integriert.
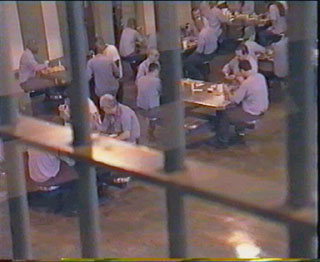 Noch
ist die EU im Hinblick auf diese Zahlen weit abgeschlagen. Mit sechs bis
zehn Mal höheren Zahlen führt die Wirtschaftsmacht USA weit vor
den anderen Industrieländern, obgleich die amerikanische Kriminalitätsrate
nur gering über dem Durchschnitt anderer Industrieländer liegt.
Deutschland mit seinen gerade einmal 50000 Strafgefangenen, auch wenn dies
Höchststand ist, kann nur mit etwa 60 Häftlingen auf 100000 Einwohner
aufwarten. Wie immer sind es überwiegend Männer in arbeitsfähigem
Alter, die überwiegende Mehrzahl zwischen 21 und 50 Jahr alt. Abgesehen
von Kanada gibt es in den meisten Industrieländern oft weit unter
100 Häftlingen auf 100000 Einwohner, wobei in Europa Großbritannien
an der Spitze liegt. Hier stiegen zwischen 1971 und 1996 die Gefangenenzahlen
um etwa 250 Prozent an, was auch für die Zunahme der Beschäftigten
allein in den staatlichen Gefängnissen gilt. Allein in den letzten
fünf Jahren wuchs die Zahl der Häftlinge ein Drittel. Derzeit
gibt es mit 65000 eingesperrten Menschen mehr als in der BRD.
Noch
ist die EU im Hinblick auf diese Zahlen weit abgeschlagen. Mit sechs bis
zehn Mal höheren Zahlen führt die Wirtschaftsmacht USA weit vor
den anderen Industrieländern, obgleich die amerikanische Kriminalitätsrate
nur gering über dem Durchschnitt anderer Industrieländer liegt.
Deutschland mit seinen gerade einmal 50000 Strafgefangenen, auch wenn dies
Höchststand ist, kann nur mit etwa 60 Häftlingen auf 100000 Einwohner
aufwarten. Wie immer sind es überwiegend Männer in arbeitsfähigem
Alter, die überwiegende Mehrzahl zwischen 21 und 50 Jahr alt. Abgesehen
von Kanada gibt es in den meisten Industrieländern oft weit unter
100 Häftlingen auf 100000 Einwohner, wobei in Europa Großbritannien
an der Spitze liegt. Hier stiegen zwischen 1971 und 1996 die Gefangenenzahlen
um etwa 250 Prozent an, was auch für die Zunahme der Beschäftigten
allein in den staatlichen Gefängnissen gilt. Allein in den letzten
fünf Jahren wuchs die Zahl der Häftlinge ein Drittel. Derzeit
gibt es mit 65000 eingesperrten Menschen mehr als in der BRD.
Privatisierung der Gefängnisse
> It is CCA's private enterprise status that allows it to fulfill> its mission of providing quality corrections at a savings to
> the taxpayer. It follows, therefore, that the credit for CCA's
> continued growth and success belongs as much to its shareholders
> as to any other group. CCA is committed to building shareholder
> value through long-term earnings growth. Correction Corporation
> of America
Seit vor sieben Jahren das erste Gefängnis in England privatisiert wurde, wurde kein staatliches mehr gebaut. Derzeit gibt es im neoliberalen europäischen Musterland sechs private Gefängnisse. "Wenigstens zwei Dutzend neuer Gefängnisse", schreibt die SZ vom 13.8.98, "müßten innerhalb der nächsten 10 Jahre gebaut werden, wenn der Trend anhält. Sie werden alle privat sein." Gefängnisse entziehen mithin nicht nur Menschen dem Arbeitsmarkt, sie schaffen neue Arbeitsplätze und werden zu einem profitablen Geschäft.
Private Prison Industry
Private Prisons von Eric Bates
Immerhin ist die Correction Corporation of America , der größte private Betreiber von Gefängnissen in den USA, an der Börse gut notiert. Seit C.C.A. 1986 an die Börse ging, stieg der Wert der Aktien von 50 Millionen Dollar auf mehr als 3,5 Milliarden im Jahr 1997 an. Man erwartet, daß in den nächsten fünf Jahren der privatwirtschaftliche Anteil am Gefängnismarkt sich mehr als verdoppelt. Derzeit befinden sich über 75000 Menschen im Gewahrsam privater Gefängnisse, davon die Hälfte in den 75 "Betrieben" der C.C.A., die "Filialen" in England, Australien und Puerto Rico besitzt. Für Investoren ist dieser Markt also eine gute Anlage, denn wie der Cabot Market Letter schreibt, gleicht C.C.A., "einem Hotel, das immer zu 100 Prozent belegt ... und bis zum Ende des Jahrhunderts ausgebucht ist."
Sicher ist das Geschäft auch, denn die privaten Gefängnissen erhalten pro Häftling einen garantierte Beitrag pro Tag. Obgleich die Privatisierung natürlich eingeleitet wurde, weil man sich Kostensenkungen erwartete, scheinen privatwirtschaftlich geführte Gefängnisse zumindest nicht wesentlich billiger zu kommen. Da die Gefägnisunternehmen aber am Profit orientiert sind und die Anstalten möglichst ökonomisch effizient betreiben, wird intern möglichst an Personalkosten, Lebensmittel, Gesundheitsversorgung etc. gespart. Personalkosten stellen den Großteil der Gesamtkosten dar.
Der Gefängnismarkt folgt seiner eigenen Logik. Um die Kosten zu
drücken und die Gewinne zu steigern, sind neu erbaute Gefängnisse
am besten, bei denen sich durch Videokameras, panoptische Transparenz und
anderen Techniken Personal einsparen läßt. Das Geheimnis liege
darin, so Russell Boraas von C.C.A., daß "eine minimale Zahl von
Angestellten eine maximale Zahl von Gefangenen beobachtet." In einem gerade
in Lawrenceville gebauten Gefängnis wird ein Wächter im High-Tech-Kontrollraum
gleichzeitig drei Trakte mit jeweils 250 Gefangenen überwachen und
jede Türe betätigen können. Für 750 Gefangene sind
tagsüber fünf und nachts zwei Wächter vorgesehen. Im neuesten
Gefängnis Großbritannien, "Her Majesty's Prison Parc" in Wales,
sitzen nur noch 13 Wächter im Kontrollraum: "Eine einzige Frau kann
von einem Kontrollpult aus", berichtet die SZ, "75 männliche Gefangene
beaufsichtigen. Sie spricht mit ihnen, ohne ihnen je gegenüberzustehen.
Sie kann jede Tür elektronisch öffnen oder schließen."
Jeder Gefangene erhält eine Smart Card mit allen Daten, so daß
dieses Gefängnis ein Vorreiter der bargeldlosen Gesellschaft ist.
Ein über Gefängnisse regulierter Arbeitsmarkt?
Die Tendenz, immer mehr Menschen schneller einzusperren, gibt es überall, doch in den USA ist sie, wie gesagt, am größten. Die Ausweitung des Strafsystems ist, wie Bruce Western und Katherine Beckett zu begründen suchen, ein direkter Eingriff in den Arbeitsmarkt, dem Menschen entzogen werden. Die geringen Arbeitslosenzahlen in den USA verdanken sich nach den Soziologen auch der steigenden Anzahl von Gefängnisinsassen, die systematisch bei den Statistiken ausgelassen werden und so die korrekten Zahlen verschleiern. "Die Größe des staatlichen Eingriffs spiegelt sich im Haushalt und in den Zahlen der Strafgefangenen. In den frühen 90er Jahren wurden für Gerichte, Polizei und Gefängnisse 91 Milliarden Dollar ausgegeben, was die 41 Milliarden Dollar weit in den Schatten stellt, die für alle Arbeitslosenunterstützungen und Beschäftigungsmaßnahmen aufgewendet wurden."
Für die Autoren stehen sich mit dem angeblichen freien Markt der
USA und den europäischen Sozialstaaten zwei Modelle gegenüber.
Aus der beschränkten Perspektive der ökonomischen Entwicklung
scheint das Modell USA, was die Arbeitslosigkeit angeht, dem Sozialstaat
überlegen zu sein. Deregulierung hat in den USA mit gegenwärtig
4,5 Prozent Arbeitslosen zur besten Beschäftigungsrate seit 28 Jahren
geführt, während in den Sozialstaaten Europas, die bis zu einem
Viertel ihres Bruttosozialprodukts gegenüber 15 Prozent in den USA
für soziale Leistungen aufwenden, die Arbeitslosenzahlen oft einige
Prozente darüberliegen. Grund für die Eurosklerose seien, so
die Ideologie, die mangelnde Deregulierung des Marktes, starke Gewerkschaften,
hohe Arbeitskosten und zu große soziale Unterstützungen. Während
die amerikanische Arbeitslosenrate jedoch niedriger ist, ist die Zahl der
Inhaftierten im Vergleich zu anderen OECD-Ländern 5 bis 10 Mal höher.
Statt im Sinne des Wohlfahrtsstaates greift der amerikanische Staat mit
seinem Gefängnissystem in den Arbeitsmarkt ein und verknappt die Arbeitsfähigen:
"Das Strafsystem erzeugt Jobs und grenzt die Menschen mit einem hohen Arbeitslosenrisiko
vom Arbeitsmarkt aus ... Das Strafsystem führt auch zu einer verschleierten
Arbeitslosigkeit, weil arbeitslose Gefangene in den normalen Beschäftigungsstatistiken
nicht einbezogen
werden."
Die Autoren schätzen, daß das Gefängnissystem die Arbeitslosenrate
um etwa 2 Prozent vermindert, während dieser Effekt bei der viel geringeren
Anzahl von Gefangenen in Europa kaum zu Buche schlägt. "In Europa
übertreffen arbeitslose Männer die männlichen Strafgefangenen
im Verhältnis von 10 oder 20 zu 1. In den USA war das Verhältnis
1990 3,5 zu 1. 1995 ist das Verhältnis dank der wachsenden Zahl der
Strafgefangenen unter 2,2 gefallen." Mit den Zahlen von 1990 geben die
Soziologen für Männer folgende bereinigte Arbeitslosenraten (in
Klammern die "unbereinigten" Arbeitslosenrate) an: USA 7 Prozent (5,6),
Großbritannien 7,5 Prozent (7,2), Deutschland 5,8 Prozent (5,5),
Frankreich 7,3 Prozent (7), Holland 5,7 (5,6) oder Dänemark 8,0 (7,8).
Beonders für die US-amerikanischen Schwarzen hat sich wenig verändert:
"Zusammenfassend weist das Wachstum des US-Strafsystems in den 80er und
90er Jahren eine hohe Rate an dauerhafter Arbeitslosigkeit auf. Bereinigte
Arbeitslosenzahlen, die den Umfang der eingesperrten Bevölkerung einbeziehen,
lassen vermuten, daß der US-Arbeitsmarkt nach 1983 nicht besser,
sondern schlechter war. Diese Auswirkungen sind besonders für die
afrikanischen Amerikaner groß. Wenn man die Strafgefangenen zur Arbeitslosenstatistik
hinzuzählt, dann ist die totale Arbeitslosigkeit unter den Schwarzen
während der Rezessionen und ökonomischen Konjunkturen bei rund
40 Prozent konstant geblieben." Einbezogen werden allerdings nicht die
Arbeitsprogramme für Strafgefangene, die mit einem Mindestlohn beschäftigt
werden. Dazu siehe Federal Prisons Industries (UNICOR).
Das Wegsperren von Arbeitslosen als Regulation des Arbeitsmarktes ist aber nur eine kurzfristig erfolgreiche Strategie, denn entlassene Strafgefangene finden nur schwer Arbeit und werden durch die "Sozialisation" im Gefängnis oft noch weiter in die Kriminalität getrieben, so daß zwei Drittel der jüngeren Insassen von Staatsgefängnissen innerhalb von drei Jahren nach ihrer Entlassung wieder eingesperrt werden. Da neben Angehörigen minoritärer Gruppen und Menschen ohne Ausbildung überwiegend junge Männer in das um sich greifende Strafsystem geraten, können die Folgen höherer Einsperrungsraten womöglich erst Jahrzehnte später zur Geltung kommen. Doch neben der boomenden Branche privatwirtschaftlich geführter Gefängnisse steht schließlich auch die private Sicherheitsindustrie in Konjunktur, die für neue Dienstleistungsjobs sorgt und gleichfalls auf die Angst vor einer gefährdeten inneren Sicherheit angewiesen ist. Aber auch wenn die teuren Gefängnisse vielleicht mehr und mehr in Konkurrenz mit häuslich Gefangenen in elektronischen Fesseln geraten, so läßt sich mit solchen Techniken ja auch Geld verdienen - und es lassen sich noch mehr Menschen in das Strafsystem eingliedern, das dem freien Markt den Rücken stärkt.
Und wenn es irgendeinen Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität geben sollte, so könnten dank dem Abbau sozialstaatlicher Leistung die Gefängnisse weiterhin Nachschub erhalten. Auch wenn die Verteilung sehr unterschiedlich ist, so steigt die Zahl der Kinder stetig an, die in den USA in Armut leben - in Kalifornen, Texas und New York gar um 20 Prozent, während die durchschnittliche Zunahme 12 Prozent beträgt. 1996 lebten 5,5 Millionen Kinder unter sechs Jahren in Armut, was zwar weniger als 1993, dafür aber weitaus mehr sind als in den frühen 80er Jahren, als es 4,4 Millionen waren. Ein Vierer-Haushalt gilt als arm, wenn er jährlich weniger als 16000 Dollar verdient, aber mehr als die Hälfte der Kinder lebten in Familien, die höchstens halb soviel Geld zur Verfügung hatten. Nach dem Children's Defense Fund vom 9. Juli 1998 wird eines von drei Kindern irgendeinmal in Armut leben und wird jedes vierte in Armut geboren. Jedes fünfte Kind lebt gegenwärtig in Armut, jedes siebte hat keine Krankenversicherung und jedes elfte gehört zu einer Familie, die weniger als die Hälfte des Geldes zur Verfügung hat, das als Armutsgrenze definiert ist.
Die Kluft zwischen den Info-Reichen und Info-Armen in den USA wird größer Grenzgänge der Inneren Sicherheit . Zum deutschen Wahlkampfthema Null Toleranz . Die deutschen Parteien preisen den starken Staat und wollen als sozialpolitische Maßnahme die Gefängnisse füllen
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/2419/1.html
EU-Polizei will ENFOPOL-Ratsbeschluss durchdrücken
Duncan Campbell 29.04.99
Dokument umbenannt, Ziele gleich geblieben. Amerikas leitende Hand wird sichtbar.
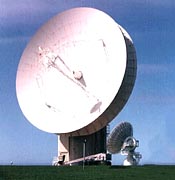 Die
letzte Version der ENFOPOL 98 Abhör- und Überwachungspläne
wurde diese Woche in London publik. Dabei stellte sich heraus, daß
zwar der Name des Schlüsseldokuments inzwischen geändert wurde,
die Europäische Kommission aber die Überwachung des Internets
immer noch bis Ende Mai zur offiziellen europäischen Politik machen
möchte. Trotz starker Opposition in Deutschland und Österreich
und harscher Kritik im Europa-Parlament wird das Vorhaben durchgedrückt.
Die
letzte Version der ENFOPOL 98 Abhör- und Überwachungspläne
wurde diese Woche in London publik. Dabei stellte sich heraus, daß
zwar der Name des Schlüsseldokuments inzwischen geändert wurde,
die Europäische Kommission aber die Überwachung des Internets
immer noch bis Ende Mai zur offiziellen europäischen Politik machen
möchte. Trotz starker Opposition in Deutschland und Österreich
und harscher Kritik im Europa-Parlament wird das Vorhaben durchgedrückt.
 Das
neue Dokument wurde ENFOPOL 19 genannt. Caspar Bowden von der Foundation
for Information Policy Research (FIPR) hat das Dokument
in seinen Besitz gebracht und auf der IFPR-Website veröffentlicht.
Das
neue Dokument wurde ENFOPOL 19 genannt. Caspar Bowden von der Foundation
for Information Policy Research (FIPR) hat das Dokument
in seinen Besitz gebracht und auf der IFPR-Website veröffentlicht.
ENFOPOL 19 wurde bei einem Treffen von Polizeibeamten in Brüssel am
11.März verfasst und von der deutschen EU-Präsidentschaft am
15.März herausgegeben. Laut der britischen Regierung hat "die deutsche
EU-Präsidentschaft angedeutet, daß man hofft über den Entwurf
des Ratsbeschlusses beim Treffen der Justiz- und Innenminister im Mai Übereinstimmung
zu erzielen". Das Treffen findet am 27. und 28. Mai statt.
 ENFOPOL 19 handelt immer noch von "Abhörmassnahmen von Telekommunikation
in Bezug auf neue Technologien". Doch anstatt einer detaillierten Aufstellung
von Anforderungen für das Anzapfen des Internets und anderer neuer
Kommunikationssysteme (wie im ursprünglichen Dokument
ENFOPOL 98), gibt die Polizeigruppe nun vor, es gehe dabei nicht
um eine neue politische Ausrichtung. Mit Verweis auf den ersten europäischen
Überwachungsplan von 1995 sagt ENFOPOL 19, "die Anforderungen der
gesetzlich ermächtigten Behörden sind auf existierende ebenso
wie neue Kommunikationstechnologien anwendbar, wie zum Beispiel satellitengestützte
Telekommunikation und Internet-Kommunikation". So behauptet das Papier,
die "technischen Richtlinien" des Plans von 1995 "sind so zu interpretieren,
daß sie ... im Falle des Internets auch für statische und dynamische
IP-Adressen, Kreditkartennummern und E-mail-Adressen zutreffen". Tatsächlich
sagt die Übereinkunft von 1995 überhaupt nichts betreffend der
Verwendung von Kreditkartennummern bei der Überwachung von Telekommunikation.
ENFOPOL 19 handelt immer noch von "Abhörmassnahmen von Telekommunikation
in Bezug auf neue Technologien". Doch anstatt einer detaillierten Aufstellung
von Anforderungen für das Anzapfen des Internets und anderer neuer
Kommunikationssysteme (wie im ursprünglichen Dokument
ENFOPOL 98), gibt die Polizeigruppe nun vor, es gehe dabei nicht
um eine neue politische Ausrichtung. Mit Verweis auf den ersten europäischen
Überwachungsplan von 1995 sagt ENFOPOL 19, "die Anforderungen der
gesetzlich ermächtigten Behörden sind auf existierende ebenso
wie neue Kommunikationstechnologien anwendbar, wie zum Beispiel satellitengestützte
Telekommunikation und Internet-Kommunikation". So behauptet das Papier,
die "technischen Richtlinien" des Plans von 1995 "sind so zu interpretieren,
daß sie ... im Falle des Internets auch für statische und dynamische
IP-Adressen, Kreditkartennummern und E-mail-Adressen zutreffen". Tatsächlich
sagt die Übereinkunft von 1995 überhaupt nichts betreffend der
Verwendung von Kreditkartennummern bei der Überwachung von Telekommunikation.
Das neue Dokument erläutert, daß es für ein Anzapfen des
Internets nicht notwendig sei, Detailinformationen über Sender und
Empfänger zu erfragen, da diese im "datagram" oder IP-Packet jeder
Nachricht enthalten sind. Deshalb würden neue Regeln für das
Internet gar nicht benötigt.
Doch das ist ein Ablenkungsmanöver. Wie den hintereinander erschienenen
revidierten Fassungen von ENFOPOL 98 zu entnehmen ist, wurde das kontroversielle
Vorhaben inzwischen in mindestens fünf Hauptbestandteile aufgebrochen,
die getrennt behandelt werden:
Die Pläne für das Abhören von Iridium und anderen persönlichen,
saellitengestützten Kommunikationsmedien wurden herausgenommen und
werden auf einer sehr hohen Ebene innerhalb der Kommission diskutiert;
Teile von ENFOPOL 98, die neue Anforderungen bezüglich persönlicher
Daten von Usern enthalten, sollen Bestandteil von "anderen, noch zu fassenden
Ratsbeschlüssen sein".
Ein anderer Ratsbeschluss wird von Internet-Service-Providern verlangen,
Hochsicherheits-Abhörschnittstellen in ihren Geschäftsräumen
einzurichten. Diese Schnittstellen sollen in einer Hochsicherheitszone
eingerichtet werden, zu der nur Personal Zutritt haben wird, das bezüglich
Sicherheit überprüft und vertrauenswürdig befunden wurde.
Das ist nicht in ENFOPOL 19 enthalten.
ENFOPOL 19 schlägt auch vor, daß einige Überwachungssysteme
über "virtuelle Schnittstellen" laufen könnten. Das wäre
spezielle bei Internetknoten zu installierende Software, ferngesteuert
von Sicherheitskräften der Regierung.
Eine vierte neue Richtlinie betreffend Kryptographie wird getrennt behandelt.
Die Arbeitsgruppe der Polizei hat nun vor, dass die alten und neuen Pläne
in einem "Handbuch" für Abhörmassnahmen zusammengefasst werden,
einschliesslich detaillierter Anweisungen zur Überwachung von Internetkommunikation.
Dabei handelt es sich um "technische Beschreibungen", die aus ENFOPOL 98
herausgenommen wurden. Wenn dieses Manöver Erfolg hat, wird sich ENFOPOL
98 der Überprüfung durch die Öffentlichkeit entziehen, indem
es in Teilen durchgeschmuggelt wird,während das Europäische Parlament
wegen der Europawahlen im Juni aufgelöst ist.
Doch das größte Geheimnis bezüglich ENFOPOL 98 wurde bisher
noch nicht zur Sprache gebracht. Das umstrittene Dokument wurde gar nicht
von europäischen Regierungen oder der Europäischen Kommission
verfasst. ENFOPOL 98 ebenso wie der Ratsbeschluss von 1995 wurden von einer
US-dominierten Expertengruppe aus dem Sicherheits- und Strafverfolgungsbereich
verfasst, die sich ILETS nennt. In dieser Gruppe gibt es weder Vertreter
der Industrie, noch Berater von Bürgerrechts- und Datenschutzanwälten.
(siehe dazu Inside ENFOPOL )
Während der letzten sechs Jahre hat ILETS im Alleingang Regierungen
und Standardisierungs-Organisationen gezwungen, ihre "Anforderungen" zum
Bestandteil von Gesetzen, Netzwerken und Kommunikationssystemen zu machen.
Die Aktivitäten dieser Gruppe wurden bisher noch in keinem Parlament
vorgetragen, weder einem nationalem Parlament, noch dem Europa-Parlament,
und auch nicht dem US-Kongress.
Nicht bevor Telepolis die ENFOPOL 98 Affäre enthüllte, wurde
die geheime Organisation ILETS öffentlich diskutiert und herausgefordert.
ILETS, die geheime Hand hinter ENFOPOL.
Anmerkung der Redaktion: Die Telekommunikations-Überwachungsverordnung
für Deutschland zeigt deutlich die Spuren von ENFOPOL 98, bzw. der
IUR (International User Requirements), ebenso wie
der Ratsbeschluss zur Bekämpfung von Kinderpornographie
http://www.heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6395/1.html
http://www.heise.de/tp/deutsch/special/enfo/default.html
ENFOPOL legalisiert ECHELON
Big Brother Preise
Florian Rötzer 22.03.99Erstmals verleiht Privacy International die Trophäe in den USA
 Während
der neunten Computers, Freedom and Privacy Conference am 6.-8. April
in Washington werden von der Menschenrechtsorganisation Privacy International
die ersten Big Brother-Preise an staatliche und private Organisationen
in den USA verliehen, die am stärksten in die Privatheit der Bürger
eingedrungen sind. Im Oktober 1998 wurden die Preise dem britischen Stützpunkt
von Echelon, dem Vorhaben des Wirtschaftsministeriums, key escrow einzuführen,
der Stadt Newham für das Videoüberwachungssystem zur Gesichtsidentifizierung
oder den Procurement Services International für den Export von Überwachungstechnologien
in Militärregime verliehen.
Während
der neunten Computers, Freedom and Privacy Conference am 6.-8. April
in Washington werden von der Menschenrechtsorganisation Privacy International
die ersten Big Brother-Preise an staatliche und private Organisationen
in den USA verliehen, die am stärksten in die Privatheit der Bürger
eingedrungen sind. Im Oktober 1998 wurden die Preise dem britischen Stützpunkt
von Echelon, dem Vorhaben des Wirtschaftsministeriums, key escrow einzuführen,
der Stadt Newham für das Videoüberwachungssystem zur Gesichtsidentifizierung
oder den Procurement Services International für den Export von Überwachungstechnologien
in Militärregime verliehen. In den USA wurden bislang Intels Pentium III, der Vorschlag von New Yorks Bürgermeister, bei allen Kindern nach der Geburt einen DNA-Test vorzunehmen, die Bemühungen von David Aaron und Ira Magaziner, starke Verschlüsselung einzuschränken und gesetzliche Regelungen zum Schutz persönlicher Daten zu verhindern, oder die Firma Elensys Inc., die medizinische Daten von Millionen von Patienten gesammelt hat, nomiiniert. Eine Jury aus Juristen, Wissenschaftlern, Journalisten und Bürgerrechtlern wird die Preise vergeben.
Privacy International will die Big Brother-Preise in möglichst vielen Ländern verleihen, um darauf aufmerksam zu machen, daß die Überwachungstechnologien sich weiter verbreitern. In einem im Oktober letzten Jahres veröffentlichten Bericht zur weltweiten Situation warnte Privacy International vor einer zunehmenden Bedrohung der Privatsphäre. Besonders die neuen Technologien untergraben jedoch die Rechte des Einzelnen, weil sie die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Verknüpfung von vielen Daten für Sicherheitsbehörden, aber auch für privatwirtschaftliche Interessen erheblich leichter machen. Neben Überwachungskameras, Sammlung von medizinischen und genetischen Daten, Smart Cards oder biometrischen Mitteln zur Identifizierung sei vor allem das Internet Gegenstand wachsender Überwachung, während die Überwachungsmöglichkeiten regelmäßig, selbst in den demokratischsten Ländern, mißbraucht werden würden. In vielen Ländern würde die Gesetzgebung hinter den technologischen Fortschritt zurückfallen, wodurch Lücken entstünden. Mehr als 90 Länder überwachen illegal die Kommunikation von politischen Gegnern, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Gewerkschaftern. Und selbst in Ländern mit strengen Datenschutzgesetzen wie in Schweden oder Norwegen würde die Polizei umfangreiche Dateien über Bürger besitzen, die weder angeklagt noch eines Verbrechens beschuldigt wurden.
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/1979/1.html
Big Brother Preis geht an Echelon
Erich Moechel 28.10.98Weitere Preise für CCTV und Key Escrow
Die Britische Abhörstation Menwith Hill wurde mit einem "Lifetime Award" für permanente Verletzung der Menschenrechte ausgezeichnet
 "Wir
waren völlig überrascht vom überwältigenden Echo seitens
der Medien und des Publikums", sagt Simon Davies, Initiator und Vorsitzender
von Privacy International , eine der renommiertesten Datenschutzgruppen
im Internet. Die Verleihung der Big Brother Awards am Montag abends in
London wurde von einem Eklat begleitet, als auf dem Videoscreen Szenen
vom Vormittag gezeigt wurden. Ein unter dem Namen Richard Makepeace bekannter
Aktivist, der den Preis - einen Stiefel, der den Kopf eines Menschen tritt
- im Department of Trade and Industry (DTI) überreichen wollte,
wurde von Polizeibeamten an den Haaren aus den Räumen der ministeriellen
Preisträger entfernt.
"Wir
waren völlig überrascht vom überwältigenden Echo seitens
der Medien und des Publikums", sagt Simon Davies, Initiator und Vorsitzender
von Privacy International , eine der renommiertesten Datenschutzgruppen
im Internet. Die Verleihung der Big Brother Awards am Montag abends in
London wurde von einem Eklat begleitet, als auf dem Videoscreen Szenen
vom Vormittag gezeigt wurden. Ein unter dem Namen Richard Makepeace bekannter
Aktivist, der den Preis - einen Stiefel, der den Kopf eines Menschen tritt
- im Department of Trade and Industry (DTI) überreichen wollte,
wurde von Polizeibeamten an den Haaren aus den Räumen der ministeriellen
Preisträger entfernt.
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/1613/1.html
Null Toleranz
Florian Rötzer 29.07.98Die Parteien preisen den starken Staat an und wollen als sozialpolitische Maßnahme die Gefängnisse füllen
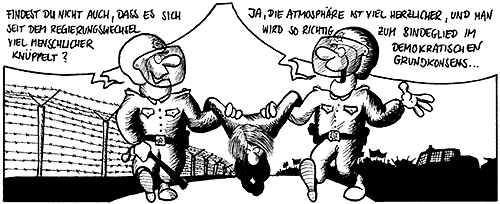
Der Platz in der Mitte wird eng. Das führt zu einer stärkeren Konkurrenz und zu einem Überbietungswettbewerb. Listig hatte die SPD die Bekanntgabe ihres Positionspapiers einen Tag vor der Veröffentlichung des CDU-CSU-Konzepts zur inneren Sicherheit gesetzt, worauf die Koalitionspolitiker in Panik gerieten und die SPD geradezu hysterisch der Heuchelei bezichtigten. Dafür legten CDU/CSU noch eins drauf, wollen neben dem Großen Lauschangriff, der von der SPD verwässert worden sei, auch den Videoangriff einführen, die Heranwachsenden bis zum Alter von 21 Jahren nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilen, die Höchststrafe im Jugendstrafrecht von 10 auf 15 Jahre heraufsetzen und härter gegenüber Sexualstraftätern vorgehen.
Natürlich müßte keineswegs das Thema der (inneren) Sicherheit zum Streitpunkt in der schmaler werdenden Nische der sogenannten Mitte werden, auch wenn dies regelmäßig in Wahlkampfzeiten hervorgeholt wird, weil man sich dadurch Punkte beim verunsicherten Wähler verspricht, der wenigstens sicher leben und die "Bösen" bestraft sehen will, wenn es ihm schon nicht besser geht und er trotzdem ruhig bleibt. Das Böse in Form von Verbrechern kann man jedenfalls identifizieren und bestrafen, was ansonsten in den komplexen Abläufen der Gesellschaft nicht so ohne weiteres möglich ist, auch wenn sie viel größeres Unheil hervorbringen. Aber ist es nicht gut, wenigstens nach innen noch den "starken Staat" demonstrieren zu können, der ansonsten bewegungsunfähig zu werden scheint und immer mehr Macht und Gestaltungsspielräumen verliert?
Einig sind sich die Konkurrenten um die Mitte, daß die Medien bedrohlich seien und Kriminalität sowie Gewalt fördern. "Eine Gesellschaft", so das Positionspapier der SPD, "die tagtäglich Gewalt im Fernsehen duldet, hat eine Mitverantwortung dafür, wenn am Ende nicht nur Gewalt konsumiert, sondern auch ausgeübt wird." Waigel sprach sich, ganz ähnlich, dafür aus, daß man gewaltverherrlichenden und abstoßenden Darstellungen in den Medien und im Internet "scharf entgegentreten". Erst unlängst hatte der bayerische Ministerpräsident Stoiber beklagt, daß "die rasante technische Entwicklung der Datennetze zu unerträglichen Sicherheitslücken" führe. Um die Überwachung und die "Schutzfunktion des Strafrechts" zu gewährleisten, kann man in der nächsten Zeit noch viel vom starken Staat erwarten, der bedenkenlos die Bürgerrechte aushebelt, um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.
Man hätte sich durchaus auch einen Wahlkampf vorstellen können,
in dem es um die besseren Konzepte einer radikalen Umgestaltung der Gesellschaft
geht. Aber die Zeichen stehen nicht gut dafür, denn alles sieht nach
Abbau und Verschlechterung aus, letztlich muß man sich nur an das
von der globalen Wirtschaft vorgegebene anpassen - mit möglichst geringen
Verlusten und Veränderungen offenbar. Die Besetzung des Wortes Innovation
verrät durchaus, daß es nicht um gesellschaftliche Neuordnung,
sondern lediglich um die Schaffung anderer "Produkte" zur Aufrechterhaltung
des Bestehenden geht. Die Alternative der großen Parteien ist in
der Tat kaum eine und reduziert sich darauf, in etwa so mit denselben Politikern
weiterzumachen oder das Personal auszutauschen, um die gleiche Politik
zumindest in den Medien mit neuen Gesichtern zu versehen. Ein Elan kann
dabei nicht aufkommen, geschweige denn ein Ruck, der durch die Gesellschaft
geht, wie ihn der Bundespräsident forderte, der sich jetzt selbst
wieder unverzichtbar machen will.
Man muß damit rechnen, daß ein weitgehend deregulierter
Arbeitsmarkt und die Privatisierung der Vorsorge für Krankheit, Alter
und Arbeitslosigkeit im Bereich niederer Einkommen und unsicherer Beschäftigungsverhältnisse
armselige Milieus am Rande des Existenzminimums entstehen läßt.
Selbst wenn sich dann die Mehrheit der Zufriedenen und Nicht-ganz-so-Zufriedenen
damit abfinden würde, den - auch vom politischen Prozeß segmentierten
- Rest einer hoffnungslos 'überschüssigen' Bevölkerung einem
repressiven Staat als Problem der inneren Sicherheit und der Armenfürsorge
zu überantworten, bliebe die erzwungene Desolidarisierung ein Stachel
im Fleisch der politischen Kultur. Jürgen Habermas: Die postnationale
Konstellation und die Zukunft der Demokratie
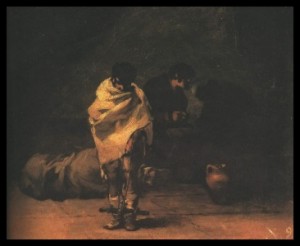 Doch natürlich sind CDU/CSU noch eher als die SPD Experten für
den starken Staat. Wird im SPD-Programm immerhin auch noch argumentiert,
daß neben der Repression die Prävention ebenso wichtig sei,
da "Kriminalität in hohem Maß Kompensation für gesellschaftliche
Benachteiligung" ist, weswegen "nur eine Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen
im lokalen Lebensumfeld der Menschen der Kriminalitätsentwicklung
auf Dauer Einhalt gebieten" könne, so hat sie doch in der Praxis alle
Verschärfungsmaßnahmen bislang mitgetragen und bietet auch keine
sozialpolitischen Maßnahmen in Ergänzung zur beabsichtigten
Gewährleistung von "innerem Frieden und innerer Sicherheit" an.
Doch natürlich sind CDU/CSU noch eher als die SPD Experten für
den starken Staat. Wird im SPD-Programm immerhin auch noch argumentiert,
daß neben der Repression die Prävention ebenso wichtig sei,
da "Kriminalität in hohem Maß Kompensation für gesellschaftliche
Benachteiligung" ist, weswegen "nur eine Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen
im lokalen Lebensumfeld der Menschen der Kriminalitätsentwicklung
auf Dauer Einhalt gebieten" könne, so hat sie doch in der Praxis alle
Verschärfungsmaßnahmen bislang mitgetragen und bietet auch keine
sozialpolitischen Maßnahmen in Ergänzung zur beabsichtigten
Gewährleistung von "innerem Frieden und innerer Sicherheit" an.
Mit den gegenwärtigen Aufmerksamkeitsattraktoren Kinderpornographie (im Internet) und Jugendkriminalität wird seltsamerweise dieselbe Zielgruppe gleichzeitig zu Opfern und zu Tätern. Muß man die Kleinen noch schützen, so soll man die Größeren am besten möglichst schnell wegsperren. Die Taz sprach kürzlich in einem Kommentar vom "Haß der Alten auf die Jungen", der hinter den Forderungen der Parteien stehe, schärfer und härter gegen auffällig gewordene Jugendliche vorzugehen und sie in geschlossenen Heimen einzusperren. Zusammen mit dem Abbau sozialstaatlicher Leistungen und der Absicht, die Polizei personell und technisch für die Ausübung von "Null Toleranz" aufzurüsten, macht das Sinn: als sozialpolitische Maßnahme. Wenn die Polizei auch bei Bagatelldelikten schnell zugreifen soll, dann vermehren sich die kriminellen Karrieren und füllen sich die Gefängnisse.
Wenn Waigel etwa eine bessere Ausrüstung der Polizei "nach bayerischem
Vorbild" ankündigt, dann ist es sinnvoll, sich von Innenminister im
Mai vorgestellte "Initiative Bayerns Sicherheit" einmal anzusehen, durch
die der Freistaat seine "Spitzenstellung als Marktführer bei innerer
Sicherheit" weiter ausbaue. Privatisierungserlöse des bayerischen
Staates werden nicht nur in High-Tech gesteckt, sondern in einer Höhe
von 75 Millionen DM auch in die Ausstattung der Streifenwagen mit mobilen
Computern, in die Verkabelung der Dienstgebäude, den Aufbau eines
landesweiten Datenverbundes für Justiz und Polizei, in den Bau einer
"Spezialeinrichtung für massiv straffällige junge Menschen",
wenn man sie nicht ausweisen kann, und in die Schaffung von 900 neuen Haftplätzen.
Eben fertiggestellt wurde ein Gebäude mit 238 Haftplätzen in
der Justizvollzugsanstalt Nürnberg. Insgesamt wurden in den letzten
5 Jahren in den 37 bayerischen Justizvollzugsanstalten ca. 350 Millionen
DM für Baumaßnahmen ausgegeben. Die Mittel zur Verbesserung
der technischen Sicherheit haben sich, so Justizminister Leeb, nahezu verfünffacht:
"Diese Investitionsmaßnahmen sollen trotz der schwierig gewordenen
Haushaltssituation", so Leeb, "auch in den kommenden Jahren zielgerichtet
fortgesetzt werden." Null Toleranz heißt auch mehr Polizisten, eine
schnellere Aburteilung und mehr Gefängnisplätze. Und wer einmal
im Gefängnis sitzt, ist nicht nur weg von der Straße, sondern
taucht in den Arbeitslosenstatistiken auch nicht mehr auf. Das ist natürlich
besonders gut bei der wachsenden Schar der Jugendlichen, die keinen Job
finden: Sicherheits- statt Sozialpolitik in Zeiten, in denen wirtschaftlicher
Wachstum ohne Schaffung neuer Jobs geschieht.
Heute triumphieren die vermeintlichen Verlierer von gestern.
Amerika hat seine Wirtschaft erneuert - und ein wahres Jobwunder
vollbracht. Mit 4,5 Prozent liegt die Arbeitslosenrate so
niedrig, daß annähernd Vollbeschäftigung erreicht ist.
Der Spiegel 31/98
Aber das ist ein Trend, der nicht nur in Deutschland herrscht. Im leuchtenden Vorbildstaat USA wurden mit der Aufrüstung der Polizei und dem Anstieg der Häftlingsquote im Zuge von Null Toleranz auch die sozialstaatlichen Leistungen radikal gekürzt. New Yorks Bürgermeister hat bereits angekündigt, die Sozialhilfe ganz zu streichen. Die Arbeitslosenrate sinkt, die Zahl der Gefängnisinsassen steigt - einen Zusammenhang sieht man nicht. Und auch in Großbritannien hat Justizminister Jack Straw ein Programm für 250 Millionen Pfund angekündigt, um die Kriminalität zu bekämpfen: "Die Maßnahmen, die ich heute angekündigt habe, werden unsere Communities zusammenhalten und stärken, eine sichere, gerechte und tolerante Gesellschaft schaffen und aus Großbritannien einen besseren Ort zum Leben machen."
 Prävention heißt hier vor allem auch, Menschen und Orte besser
überwachen sowie Polizei und Strafvollzug effizienter zu machen. 660
Millionen Pfund sind überdies für die Vergrößerung
der Gefängniskapazitäten vorgesehen. Für die Konservativen
ist das alles nicht genug, bei denen die Polizei eine höhere Priorität
genossen habe und die während ihrer 18-jährigen Regierungszeit
14 Prozent mehr Polizisten eingestellt hätten, wie Sir Norman kritisierte.
Prävention heißt hier vor allem auch, Menschen und Orte besser
überwachen sowie Polizei und Strafvollzug effizienter zu machen. 660
Millionen Pfund sind überdies für die Vergrößerung
der Gefängniskapazitäten vorgesehen. Für die Konservativen
ist das alles nicht genug, bei denen die Polizei eine höhere Priorität
genossen habe und die während ihrer 18-jährigen Regierungszeit
14 Prozent mehr Polizisten eingestellt hätten, wie Sir Norman kritisierte.
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/glosse/2413/1.html
Werden oder sind die "Verschwörungstheorien" Realität?
die verschwörung: 666
Teil der »Neuen Weltordnung« ist die »Bargeldlose Gesellschaft«.
Durch ihre Vorarbeit bei der Einführung von elektronisch lesbaren Scheck- und Kreditkarten, Telefonkarten, Krankenversicherungskarten, Benzinkarten der einzelnen Oelkonzerne usw. haben die Herrschenden die Menschen entscheidend darauf vorbereitet. Mit dem Argument, der bargeldlose Zahlungsverkehr sei sicherer, einfacher und praktischer, konnten die Massen erfolgreich von den Vorzügen dieses Systems überzeugt werden. Dieses Modell braucht nur noch zu Ende gedacht werden. Sobald die Menschen eine Vielzahl elektronisch lesbarer Karten mit sich herumtragen müssen, wird man ihnen erzählen, daß es noch einfacher und praktischer sei, anstelle der vielen Karten nur eine einzige Karte zu haben.Das ist die Debitorenkarte, die sogenannten EINE-KREDITKARTE FÜR- ALLES, die in Neuseeland, Australien und Kanada bereits eingeführt ist. Dort gibt es zwar weiterhin auch andere Kreditkarten, die Debitorenkarte (Debit-Card) ist jedoch bereits im Umlauf
Die Endlösung ist aber die Lasertätowierung. Für das Auge unsichtbar, wird mit einem Laserstrahl ein Bar-Code (Strich-Code) auf die rechte Hand oder auf den Stirnknochen tätowiert. Das heißt, daß der Code auf Ihrer Hand wie die Debitorenkarte als Zahlungsmittel und zusätzlich als Identifikation nützlich ist. Es wird nachher nur noch mit einem Scanner über Ihren Code auf der Hand gestrichen und schon ist jede gewünschte Information parat.
Derartige Überlegungen sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern bitterer Ernst. Die Lasertätowierung wurde 15 Jahre lang im Disneyland getestet. Man gab den Personen, die sich mehrere Tage dort aufhielten, die Möglichkeit, sich zwischen einer Dauerkarte oder einer Lasertätowierung in die linke Hand zu entscheiden. Hiermit wollte man testen, wie die Leute darauf reagieren würden und ob sie sich mit der Zeit daran gewöhnen.
Amtliche Vordrucke mit der Anfrage, wo man die Markierung tragen will: F = Forehead (Stirn) oder H = Hand, sind bereits international vorbereitet. Dies sind Tests, um das Volk schon langsam daran zu gewöhnen, bevor es zur Pflicht wird. In Holland soll man schon vor sieben Jahren begonnen haben, Obdachlosen eine Lasertätowierung auf den Vorderstirnknochen zu machen. Dem Volk sagte man, man könne dadurch die Kriminalität, speziell in Amsterdam, eindämmen. Inzwischen ist diese Lasertätowierung zum Teil schon offiziell eingeführt.
Mit dem Argument, Geschäftsreisende schneller abfertigen zu können, sind auf amerikanischen Flughäfen spezielle Geräte zum Ablesen dieser unsichtbar auf der rechten Hand eintätowierten Markierung installiert worden. Und die Zahl derer, die diesen Service in Anspruch nehmen, nimmt ständig zu, denn Zeit ist Geld.
Man wird Sie nicht unbedingt dazu zwingen, diese Tätowierung anzunehmen, es wird Ihnen jedoch nicht viel übrigbleiben, es sei denn, Sie sind Selbstversorger. Irgendwann wird man in den Geschäften kein Bargeld mehr annehmen. Und man wird den Völkern aufzeigen, wie sicher diese Methode ist. Kein Diebstahl ist mehr möglich, denn da, wo kein Geld ist, kann auch nichts geklaut werden. Jeder Verbrecher kann über die Lasertätowierung per Satellit ausfindig gemacht werden und illegale Grenzübertritte werden auch nicht mehr möglich sein.
Doch in Wahrheit wird es die absolute Kontrolle des Menschen sein. Aus ist es dann mit dem freien Willen, jeder ihrer Schritte wird überwacht, alles was sie tun, was Sie besitzen, wieviel Kapital Sie haben, wo Sie sich aufhalten, was Sie kaufen und verkaufen, jede Information wird für »Big Brother« abrufbar. Machen Sie sich die Mühe und lesen Sie George Orwells Buch »1984«, darin wird dieses geplante Sklavensystem der Neuzeit sehr schön beschrieben.(138)
In der Offenbarung des Johannes 13:16-18 heibt es:
» ... Und es (das Tier, d. Verf.) bewirkt, daß sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen an die rechte Hand oder an die Stirn machen, und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier geht es um Weisheit! Wer Verstand hat, der deute die Zahl des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.,,
Die Zahl 6 symbolisiert in der Kabbala, wie auch die Tarotkarte Nummer 6 (»Die Liebenden»), die Versuchung, der Weg aus dem Geistigen in die Materie, während die Zahl 9, die Zahl der Weisheit, den Weg aus der Materie zurück ins Geistige symbolisiert.
Die Hopi-Indianer in Nord-Arizona haben auch eine Prophezeiung, und die sagt: »Keiner wird kaufen oder verkaufen können, wenn er nicht das Zeichen des Bären hat. Wenn dieses Zeichen zu sehen sein wird, dann kommt der Dritte Große Krieg ...
Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel zur Deutung dieser Offenbarung:
»Das Tier« in diesem Abschnitt wird im Englischen als »The
Beast« bezeichnet. Das Zeichen des Bären sieht so aus:
 Sie
müssen sieh vorstellen, wie dem Indianer vor mehreren hundert Jahren
eine Vision gezeigt wird, auf dem er den Bar-Code erblickt. Da er diesen
natürlich nicht unter diesem Namen kennt, beschreibt er, daß
dieses Zeichen aussieht, wie die Spuren des Bären, wenn er seine Krallen
schärft. Die Strichmuster auf den einzelnen Handelsprodukten enthalten
verschiedene Linien, die nach Stärke und Abstand eine bestimmte Zahl
darstellen, wodurch das bestimmte Produkt nach einem binären Zahlensystem
identifiziert werden kann. Sie sehen die zwölf kürzeren Doppelstreifen,
wie die Krallenspuren des Bären, sechs links und sechs rechts (zu
Anfang waren es fünf). Dazu kommen DREI längere, links außen,
rechts außen und in der Mitte. Wenn Sie jetzt bei den kürzeren
Streifen die Zahl 6 heraussuchen (zwei dünne Striche) und sie mit
den längeren Streifen vergleichen, werden Sie sehen, daß die
längeren Streifen auch eine 6 darstellen, nur steht sie unter diesen
nicht. Die drei längeren Streifen sind und bleiben auf jedem Bar-Code
auf der Welt gleich, nur die kürzeren verändern sich. Der Computer
ließt also immer 666.
Sie
müssen sieh vorstellen, wie dem Indianer vor mehreren hundert Jahren
eine Vision gezeigt wird, auf dem er den Bar-Code erblickt. Da er diesen
natürlich nicht unter diesem Namen kennt, beschreibt er, daß
dieses Zeichen aussieht, wie die Spuren des Bären, wenn er seine Krallen
schärft. Die Strichmuster auf den einzelnen Handelsprodukten enthalten
verschiedene Linien, die nach Stärke und Abstand eine bestimmte Zahl
darstellen, wodurch das bestimmte Produkt nach einem binären Zahlensystem
identifiziert werden kann. Sie sehen die zwölf kürzeren Doppelstreifen,
wie die Krallenspuren des Bären, sechs links und sechs rechts (zu
Anfang waren es fünf). Dazu kommen DREI längere, links außen,
rechts außen und in der Mitte. Wenn Sie jetzt bei den kürzeren
Streifen die Zahl 6 heraussuchen (zwei dünne Striche) und sie mit
den längeren Streifen vergleichen, werden Sie sehen, daß die
längeren Streifen auch eine 6 darstellen, nur steht sie unter diesen
nicht. Die drei längeren Streifen sind und bleiben auf jedem Bar-Code
auf der Welt gleich, nur die kürzeren verändern sich. Der Computer
ließt also immer 666.
Und ich verspreche Ihnen, daß Sie, wenn sich nicht grob etwas ändert,
ohne den Bar-Code bald nicht mehr einkaufen können. Irgendwann bekommen
Sie ihn dann eben auf die Hand oder die Stirn.
Dazu kommt, daß der größte Computer der Welt, an den alle
anderen angeschlossen sind, in Brüssel steht und »La Bête«
(»The Beast«) genannt wird.
Die Frage, wie man es anstellen wird, den Bar-Code den Menschen aufzuzwingen,
ist nicht schwer zu beantworten. Die internationalen Bankiers werden, anstatt
vereinzelte kleine Wirtschaftskrisen, diesmal eine Weltwirtschaftskrise
verursachen, die die schlimmste sein wird, die es je gegeben bat. Man wird
dieses Geschehen dazu benutzen, um eine Weltwährung und eine absolut
kontrollierende Weltbank zu errichten und gleichzeitig das ausschließlich
bargeldlose Zahlungssystem einzuführen. Und nachdem alle Bankensysteme
der Welt zusammengebrochen sein werden und es keine Alternative zu der
Debitorenkarte geben wird, werden die Menschen diese akzeptieren müssen.
Man wird in keinem Geschäft mehr mit Bargeld bezahlen können.
Der einzige Ausweg, die Karte und später die Tätowierung zu umgehen,
ist es, Selbstversorger zu sein. Etwa Gold oder Silber zu haben, und etwas
zu produzieren (Landwirtschaft oder Handwerk), das
Sie für etwas anderes eintauschen können. Daher ist es auf jeden
Fall unumgänglich, auf dem Land zu wohnen, da eine unabhängige
und selbstversorgende Existenz in der Stadt so gut wie unmöglich ist.